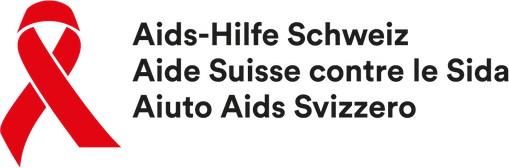Die Zukunft der HIV-Therapie
Am 19. Januar fand im Eventlokal Kraftwerk in Zürich ein Symposium zum Thema «Zukunft der HIV-Therapie» statt. Ein Symposium, das Vertreter der Patientenorganisationen von Menschen mit HIV initiiert hatten. Organisatorin war die Klinik für Infektionskrankheiten des Universitätsspitals Zürich.
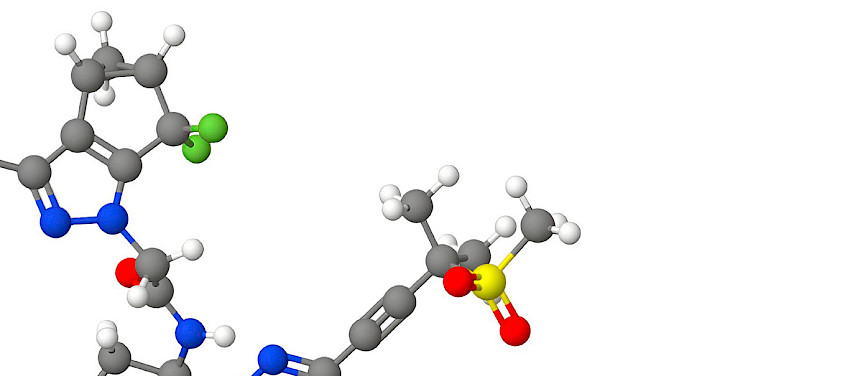
Dominique Laurent Braun
arbeitet als Oberarzt mit erweiterter Verantwortung an der Klinik für
Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich und ist Privatdozent für Infektiologie an der Universität Zürich. Seine Forschungsgebiete sind HIV, Hepatitis C und sexuell übertragbare
Infektionskrankheiten.
Dominique Braun | April
Eingeladen waren Menschen mit HIV, Ärzt:innen, diverse Personen aus dem Gesundheitswesen, Vertreter:innen der Aids-Hilfen und weitere Stakeholder, um über neue HIV-Therapien und die Bedürfnisse von Menschen mit HIV zu diskutieren. Dominique Braun, Mitorganisator des Symposiums, hat für die Swiss Aids News wichtige Erkenntnisse der Veranstaltung zur HIV-Therapie zusammengefasst.
Die Zukunft der HIV-Therapie
Erfreulicherweise wird auch Jahrzehnte nach der Entdeckung des HI-Virus weiterhin intensiv nach neuen HIV-Medikamenten geforscht. Der Grund hierfür ist einfach zu nennen: Das perfekte HIV-Medikament ohne Langzeitnebenwirkungen existiert noch nicht, und es besteht weiterhin das Bedürfnis nach neuen medikamentösen Therapieoptionen. Betrachtet man den globalen Bericht zur Pipeline neuer antiretroviraler Medikamente, zählt man über 15 Substanzen, die sich momentan in klinischer Erprobung befinden. Beeindruckend ist, dass darunter viele neue Wirkklassen und neue Verabreichungsformen zu finden sind. Als Beispiel hierfür zu nennen sind implantierbare Devices, subkutane oder intramuskuläre Injektionen, Mikro-Patches, monoklonale Antikörper und spezielle Moleküle, welche nach Einnahme im Magen verbleiben, dort ihre Wirkung über mehrere Wochen entfalten und anschliessend natürlicherweise abgebaut werden. Dies hört sich noch etwas nach Zukunftsmusik an, und tatsächlich ist momentan unklar, wie viele dieser neuen Applikationen dereinst auf dem Markt zugelassen werden. Am weitesten fortgeschritten in der Entwicklung sind zwei Medikamente, auf welche hier näher eingegangen werden soll: Lenacapavir und Islatravir.
Das perfekte HIV-Medikament ohne Langzeitnebenwirkungen existiert noch nicht, und es besteht weiterhin das Bedürfnis nach neuen medikamentösen Therapieoptionen.
Lenacapavir: ein neuartiger Kapsidhemmer
Seit vielen Jahren verfolgen Forscher und Menschen mit HIV gespannt die Studienergebnisse eines HIV-Medikaments namens Lenacapavir, das zur neuartigen Klasse der HIV-Kapsidhemmer gehört. Das HIV-Kapsid stellt die natürliche Schutzhülle dar, welche das Erbgut von HIV umgibt, und ist bei vielen Schritten im HIV-Vermehrungszyklus involviert. Lenacapavir hemmt das Kapsid und weist somit mehrere Wirkmechanismen gleichzeitig auf, was für HIV-Medikamente neuartig ist. Erforscht wird Lenacapavir bei Menschen mit schwer vorbehandelter HIV-Infektion und nur noch wenigen oder gar fehlenden Therapieoptionen. Verabreicht wird Lenacapavir als Medikament zum Schlucken und im Verlauf als Injektionen mit Langzweitwirkung. Das Interessante daran: Im Gegensatz zu den aktuell auf dem Markt zugelassenen zweimonatlichen intramuskulären Injektionstherapien wird Lenacapavir ins Unterhautfettgewebe verabreicht und dies im sechsmonatlichen Intervall. Somit könnte die Selbstverabreichung durch die Patientin, den Patienten möglich sein.
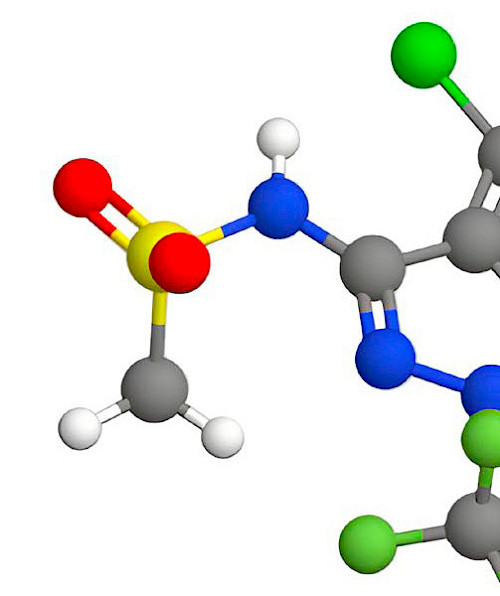
Grosses Potenzial
Die Potenz von Lenacapavir ist hoch: Bei Patient:innen mit Mehrklassenresistenz zeigt sich nach einem Jahr in über 80 Prozent der Fälle eine unterdrückte HIV-Viruslast, wenn Lenacapavir zusätzlich mit anderen HIV-Medikamenten mit noch etwas Wirkung kombiniert wird. Auch bei Patient:innen, die noch keine HIV-Behandlung hatten, wird Lenacapavir erforscht. Auch in dieser Gruppe ist die Anzahl Patient:innen mit unterdrückter Viruslast nach einem Jahr Behandlung sehr hoch. Momentan läuft eine Vielzahl von Studien, welche Lenacapavir in verschiedenen Kombinationen und Verabreichungsformen untersuchen, darunter auch eine vielversprechende Zweifach-Kombination von Lenacapavir mit dem potenten HIV-Integrasehemmer Bictegravir. In einigen europäischen Ländern wurde Lenacapavir für schwer vorbehandelte Personen bereits zugelassen. Bis Lenacapavir in der Schweiz verfügbar ist, wird es mutmasslich aber noch einige Jahre dauern.
Islatravir: ein neuartiges HIV-Molekül mit unklarer Zukunft
Die Entwicklung von Islatravir hat bei Forschenden und Patient:innen in der Vergangenheit ein Wechselbad der Gefühle ausgelöst – doch dazu später. Ähnlich wie Lenacapavir gehört Islatravir zu einer neuen HIV-Wirk-
klasse, den sogenannten nukleosidischen Re-
verse-Transkriptase-Translokations-Hemmern. Es hemmt den HIV-Vermehrungszyklus an zwei Stellen und zeichnet sich durch eine hohe Potenz aus. Einmal verabreicht, verbleibt Islatravir bis zu 200 Stunden im Körper und bietet sich somit als Injektionstherapie mit Langzeitwirkung an. Zudem wirkt Islatravir auch noch, wenn andere HIV-Medikamente aufgrund aufgetretener Mutationen bereits unwirksam geworden sind. Allerdings wurde die Entwicklung von Islatravir in der Vergangenheit aufgrund einer überraschenden
Nebenwirkung fast gestoppt – und hat nun nach zahlreichen Untersuchungen doch wieder eine Auferstehung gefeiert.
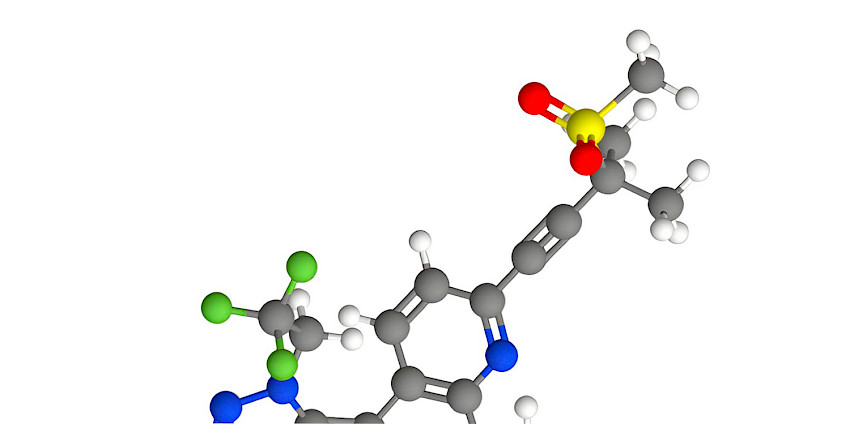
Das Gewicht im Griff
Die Nebenwirkung bestand darin, dass sich bei einer Anzahl von Studienpatient:innen, welche Islatravir als einmal wöchentliche Therapie zum Schlucken in hoher Dosierung eingenommen hatten, ein Abfall der T-Helferzellen gezeigt hatte. Der Hersteller konnte nun in neuen Studien nachweisen, dass diese Nebenwirkung bei täglicher Einnahme in einer sehr viel niedrigeren Dosierung nicht auftritt und die Wirksamkeit weiterhin hoch bleibt. Zudem zeigten sich unter Islatravir in den bisherigen Studien keine Hinweise auf eine übermässige Gewichtszunahme bei den Studienteilnehmenden. Dies ist deshalb nennenswert, da ein übermässiger Gewichtsanstieg unter Therapie mit den weltweit millionenfach eingesetzten HIV-Integrasehemmern auftreten kann und dieser Gewichtsanstieg möglicherweise zu Folgekomplikationen wie Bluthochdruck, Herzinfarkten und Diabetes mellitus führt. In der Schweiz ist eine weltweite Studie mit der Zweifachkombination Islatravir/Doravirin vor Kurzem gestartet. Bleibt zu hoffen, dass Islatravir zukünftig die antiretrovirale Therapie-Palette um eine vielversprechende Option erweitern wird.
Zukunft bereits jetzt: langwirksames Cabotegravir und Rilpivirin
Was lange Zeit noch Zukunft war, ist in der Schweiz seit einem Jahr Gegenwart: die Therapie mit der langwirksamen Injektionstherapie Cabotegravir und Rilpivirin. Beide Medikamente werden in zweimonatlichen Intervallen gleichzeitig in die beiden Gesässmuskeln verabreicht. Wichtig zu wissen ist, dass diese Injektionstherapie nur bei Personen möglich ist, welche bereits unter einer antiretroviralen Therapie stehen, dabei eine unterdrückte Viruslast aufweisen und in der Vergangenheit kein Therapieversagen hatten. Da eine Injektion in den Muskel bei unsachgemässer Verabreichung zu Komplikationen führen kann, muss die Therapie durch eine Medizinalperson verabreicht werden. Es sei hier erwähnt, dass die Herstellerfirma in laufenden Studien eine alternative Verabreichung ins Unterhautfettgewebe untersucht, welche dereinst eine Selbstverabreichung durch die Patient:innen ermöglichen könnte. In Deutschland ist das langwirksame Cabotegravir/Rilpivirin bereits seit zwei Jahren auf dem Markt, entsprechend konnte der Symposiumsreferent aus Deutschland, Privatdozent Christoph Wyen, bereits mit etwas Erfahrung über diese Therapieoption sprechen. Wyen erzählte, dass die langwirksame Therapie mit Cabotegravir und Rilpivirin bei seinen Patient:innen auf Anklang stosse und sich eingangs gestellte Befürchtungen unter anderem bezüglich Logistik in seiner Praxis nicht bewahrheitet hätten.
Nicht für alle gleicht gut
Trotz der überwiegend positiven Rückmeldungen der Patient:innen unter Cabotegravir/Rilpivirin wechseln nach einem Jahr circa 10 Prozent der Patient:innen wieder auf die alte Therapie in Schluckform zurück, da sie die zweimonatlichen Termine für die Verabreichung der Medikamente in der Praxis nicht einhalten können oder unter Nebenwirkungen im Bereich der Injektionsstelle leiden. Im Einklang mit den Studiendaten, welche bei richtiger Selektion der Patient:innen eine sehr hohe Wirksamkeit von Cabotegravir/Rilpivirin gezeigt haben, sieht auch Wyen bei der sehr grossen Mehrzahl der Patient:innen unter Cabotegravir/Rilpivirin eine unterdrückte Viruslast. Wyen berichtet aber auch von einem ungeklärten Fall, in dem es trotz sachgemässer Verabreichung zu einem virologischen Versagen mit Resistenzentwicklung gekommen sei – einem Phänomen, das insgesamt sehr selten ist, aber für die Betroffenen gravierende Folgen haben kann.
Fazit: HIV-Heilung als Ziel
In Bezug auf neue Medikamente und innovative Verabreichungsformen stellt sich die Zukunft der Behandlung der HIV-Infektion glanzvoll dar – insbesondere, da auch seitens Firmen und Ärzt:innen weiterhin ein grosser Forschungswille besteht. Es sei allen Patient:innen gedankt, welche bereit sind, an Studien zur Erforschung neuer Medikamente teilzunehmen. Denn nur durch Forschung erreicht man Fortschritt. Dabei soll nicht vergessen gehen, dass wir alle zusammen weiterhin ein ultimatives Ziel erreichen wollen: die HIV-Heilung. Dieses Thema soll aber Gegenstand eines zukünftigen Symposiums sein – und Platz in den SAN finden.