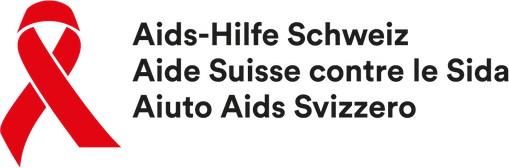«Die erste Frage gilt immer dem Allgemeinbefinden»
Claudia Bernardini arbeitet als Infektiologin und HIV-Spezialistin in der Arud, einer führenden Einrichtung für suchtkranke Menschen in der Stadt Zürich. Sie betreut, berät und versorgt Menschen mit HIV medizinisch. Ein Interview zur HIV-Therapie.

INTERVIEW: Brigitta Javurek | Oktober 2021
Was gehört in ein Erstgespräch mit HIV-positiven Menschen?
Oft kommen neue Patient_innen zu mir, die bereits HIV-Medikamente einnehmen. Ich versuche mir dann ein Bild zu machen, eine Übersicht zu verschaffen: Wie lange nehmen sie diese Medikamente schon ein, gibt es besser geeignete? Ich lese ihre Krankengeschichte, wenn ich sie erhalte, sorgfältig durch und mache dann mit der Patientin, dem Patienten eine Anamnese, so erfahre ich alle relevanten Informationen. Die erste Frage gilt immer dem Allgemeinbefinden. Wenn die Person nicht weiss, welches Medikament sie in der Vergangenheit genommen hat und die Informationen von anderen Ärzten noch nicht vorliegen, schauen wir gemeinsam die Medikamententabelle an und versuchen die Medikamente zu bestimmen. Ich frage auch nach Schlafstörungen, der psychischen Gesundheit, ob und welche Drogen sie konsumieren, nach der Tagesstruktur, dem sozialen Umfeld, den bisherigen Erfahrungen und vielem mehr. Dann mache ich eine klinische Untersuchung und Blutkontrolle, um den Allgemeinzustand der Patientin, des Patienten einzuschätzen.
«Die erste Frage gilt immer dem Allgemeinbefinden. Wenn die Person nicht weiss, welches Medikament sie in der Vergangenheit genommen hat und die Informationen von anderen Ärzten noch nicht vorliegen, schauen wir gemeinsam die Medikamententabelle an und versuchen die Medikamente zu bestimmen.»
Nach welchen Richtlinien verschreiben Sie Ihren Patient_innen die
Ich halte mich an die europäischen Richt-linien (EACS). Da wird unter anderem festgehalten, wann eine Therapieumstellung sinnvoll ist, mit welchen Medikamenten man beginnen sollte, welche Spezialfälle es gibt. Die Richtlinien werden immer wieder angepasst, und ich kenne sie auswendig. Wichtiger sind für mich aber die Kongresse, die ich alle Jahre besuche, auch Online-Seminare sowie Informationen der Pharmakonzerne. So weiss ich bereits früher, was ansteht, was kommt, und ich kann mir mögliche Therapieverbesserungen für meine Patientinnen und Patienten überlegen. Bereits seit 2005, als ich noch eine junge Ärztin war, arbeite ich mit HIV-Betroffenen. In all dieser Zeit habe ich ein grosses Wissen über die Geschichte der HIV-Medikamente gesammelt. Ich erinnere mich, wie diese zum Beispiel noch im Kühlschrank gelagert werden mussten und ein Mehrfaches an Aufwand und Nebenwirkungen für die Betroffenen bedeuteten. Meist verschreibe ich die Medikamente, die in den Richtlinien empfohlen sind. Es kann aber auch anders sein. Ich denke da an Medikamente, die zum Beispiel zu Gewichtszunahme oder zu psychischen Nebenwirkungen führen können. Viele meiner Patient_innen leiden unter psychischen Erkrankungen und haben manchmal keinen gesunden Lebensstil. Diesen verschreibe ich je nach Einschätzung Medikamente, die zurzeit von den Richtlinien nicht als First-Line-Therapie empfohlen werden.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie eineTherapie umstellen?
Es ist zentral, dass Patien_innen die Therapie gut vertragen, nur so sind sie motiviert und nehmen die Medikamente regelmässig ein. Wichtig ist auch, dass die Therapie funktioniert und geringe Interaktionen mit anderen Medikamenten hat. Leiden Patient_innen unter gravierenden Nebenwirkungen, sind sie froh und motiviert, eine neue Therapie zu beginnen. Wenn die Therapie gut ankommt, was sehr häufig der Fall ist, prüfe ich, ob sich allenfalls andere Nebenwirkungen zeigen – wie etwa die Cholesterin-, Nieren- und Leberwerte aussehen, was die Urinprobe aussagt und so weiter. Ich gehe Schritt für Schritt alle Möglichkeiten durch. Manche Nebenwirkungen spürt eine Patientin, ein Patient nicht, aber gewisse kumulative Nebenwirkungen müssen auf lange Sicht etwa punkto kardiovaskuläre oder Osteoporose-Risiken im Auge behalten werden. So kann es sein, dass ich, wenn ein verbessertes Medikament auf den Markt kommt, einer Patientin, einem Patienten vorschlage, das Medikament zu wechseln. Dadurch können zum Beispiel auf lange Sicht die Risiken reduziert werden.

Was, wenn es Probleme bei der Umstellung gibt?
Schwere Nebenwirkungen sind heutzutage zum Glück sehr selten. Wenn es doch dazu kommt, kann eine Patientin, ein Patient die Medikamente kurz absetzen, einen Termin abmachen, und dann schauen wir gemeinsam, wie es weitergeht. Aber das passiert wie gesagt nicht oft. Meist treten die Nebenwirkungen am Anfang auf und verschwinden nach kurzer Zeit. Es braucht Geduld, und im Vorfeld besprechen wir gemeinsam alle Probleme, die auftreten können. Ich arbeite proaktiv: Ich gehe auf meine Patient_innen zu, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Dies hat sich bewährt und schafft Vertrauen. Ich bin auch per Mail erreichbar und beantworte jede Frage so rasch wie möglich. Ausserdem ist in Notfällen in der Arud immer ein Dienstarzt, eine Dienstärztin anwesend.
«Eines meiner Prinzipien ist eine gute medizinische Versorgung für alle. Dies kann ich jeden Tag in der Arud umsetzen».
Geschlecht, Status, sexuelle Orientierung, Herkunft der Patient_innen sind unterschiedlich. Wie gehen Sie damit um?
Ja, da ist so. Zwischen einem jungen Schwulen mit regelmässig wechselnden Sexpartnern und einem älteren Drogenabhängigen ohne Libido bestehen grosse Unterschiede, obwohl beide HIV-positiv sind. Bei Frauen ist es nochmals anders. In meiner Arbeit ist die sexuelle Anamnese sehr wichtig für die Schadensminderung. Ich frage immer: Welche sexuelle Orientierung haben Sie? Sind Sie in einer festen Beziehung, oder haben Sie mehrere Partner? Wie viele? Sprachlich kann ich genug abdecken: Deutsch, Englisch, Italienisch. Wenn es mit der Verständigung nicht klappt, dann versuche ich es mit Zeichnen, mit dem Zeigen von Bildern oder mit Google Translator. Die Arud praktiziert eine Art Hausarztmodell mit verschiedenen Angeboten unter einem Dach: Psychiatrie, Suchtmedizin, innere Medizin, Infektiologie. Seit einigen Monaten bieten wir für Frauen sogar eine gynäkologische Vorsorge.
Wie machen Pharmavertreter_innen Werbung für ihre Angebote?
Sie kontaktieren mich via Mail, dann vereinbaren wir einen Termin. Ich lasse mich gern von den Pharmakonzernen informieren – aber ich lasse mich nicht drängen, ich verlasse mich auf meine Erfahrung.
Was bringt die Zukunft?
Ich bin froh, wenn Betroffene in Zukunft nicht mehr jeden Tag Tabletten einnehmen müssen. Das ist nicht immer einfach, besonders für junge Menschen. Klar, auch von Diabetes oder Bluthochdruck Betroffene nehmen täglich Tabletten ein, und ein einzelnes Medikament ist nicht dramatisch. Aber für Menschen, die es nicht fertigbringen, sich jeden Tag an ihre Tabletten zu erinnern, kann ein Langzeitimplantat oder eine monatliche Spritze eine Lösung sein. Eine meiner Patientinnen schafft es trotz enger Begleitung nicht unter die Nachweisgrenze. Wir durchschauen nicht genau, warum das so ist, vermuten aber, dass sie die Tabletten ausspuckt und verkauft. Immerhin wissen wir, dass bei ihr die Therapie funktioniert, denn im Gefängnis war sie unter der Nachweisgrenze. Für jemanden wie sie könnte ein Langzeitimplantat das Richtige sein. Ihre Geschichte ist jedoch ein extremer Fall. Aber auch Frauen in armen Ländern, die einen schlechten Zugang zu medizini-scher Versorgung haben und mit Diskriminierungen leben müssen, wären Kandidatinnen für eine solche Lösung. Die zweimonatliche Spritze kommt hingegen für etliche meiner Patient_innen nicht infrage, da nicht wenige unter einer Spritzenphobie leiden.
Sie spritzen nicht mehr und befürchten einen Rückfall. Oder sie wollen, was paradox klingen mag, nicht von jemand anderem eine Spritze erhalten.
ARUD
1991, ein Jahr bevor der Zürcher Platzspitz, die damals weltweit grösste offene Drogenszene, geschlossen wird, wird die Arbeitsgemeinschaft für risikoarmen Umgang mit Drogen (Arud) gegründet. Sie gibt Spritzen ab und betreut die Süchtigen medizinisch so gut wie möglich. Ab 1992 bietet sie die ersten niederschwelligen methadongestützten Behandlungen für Heroinabhängige an. 1995 richtet die Arud eine eigene Forschungsabteilung ein, im Jahr 2000 lanciert sie eine Hepatitis-C-Aufklärungskampagne. Heute bietet die Arud individuelle Unterstützung und Behandlung bei allen Suchterkrankungen: von Problemen mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen bis hin zu Verhaltenssüchten. Sie ist ausserdem spezialisiert auf die Behandlung von HIV und Hepatitis C. www.arud.ch