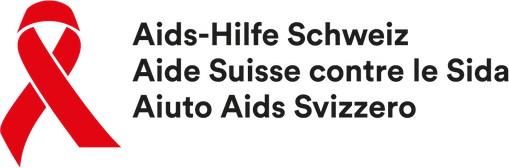«Das Swiss Statement war kein Kaffeesatzlesen, sondern beruhte auf wissenschaftlichen Daten»
2008 brach die Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen (EKAF) eine Lanze für HIV-positive Menschen unter erfolgreicher Therapie. Ihr sogenanntes Swiss Statement schlug hohe Wellen und wurde längst nicht überall begrüsst.

Enos Bernasconi
Chefarzt der Abteilung Infektionskrankheiten des Regionalspitals Lugano. Er unterrichtet an der Universität Genf und ist Mitglied der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie. Von 2001 bis 2007 war er Präsident der Eidgenössischen Kommission für Aids-Fragen (EKAF), der heutigen Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG).
November 2018 | Brigitta Javurek
Professor Bernasconi, zehn Jahre Swiss Statement, aber noch immer kennen Heidi Durchschnitt und Otto Normalo die Bedeutung von «nicht nachweisbar = nicht übertragbar» nicht. Warum?
Das stimmt. Die Gründe, warum noch längst nicht alle das Statement kennen, sind vielfältig. Ein Grund ist sicher, dass wir das Statement 2008 für die Betroffenen, also für HIV-positive Frauen und Männer, freigaben. Sie sollten keine Angst mehr vor einer Übertragung haben und sich mit einer funktionierenden Therapie sexuell entspannen dürfen, wenn sie es wünschten. Und HIV-positive Frauen mit Kinderwunsch konnten ohne mögliche Ansteckung Kinder gebären. Eine zusätzliche wichtige Information war die damalige schwierige juristische Situation für Menschen mit HIV, denn die Kriminalisierung in der Schweiz war ganz schlimm. HIV-positive Frauen und Männer galten rechtlich als Risikofaktoren für die Verbreitung einer sexuell übertragbaren Infektion. Dies änderte sich mit dem Statement, denn wer unter der Nachweisgrenze ist, kann das HI-Virus nicht mehr weitergeben und somit auch nicht für die Weitergabe einer sexuell ansteckenden Infektion verurteilt werden. Bereits 2009, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Statements, wurde Professor Bernhard Hirschel, ein Mitglied der EKAF, in einem schweizerischen Rechtsverfahren beigezogen, und aufgrund seiner Aussagen wurde der HIV-positive Angeklagte nicht verurteilt. Ohne das Swiss Statement wäre das nicht möglich gewesen.
Was war die Aufgabe der Kommission?
Die EKAF bestand aus Frauen und Männern aus den verschiedensten Bereichen. Da waren Ärzte, Psychologen, Soziologen, Juristen, Vertreter der Aids-Hilfe Schweiz und auch Betroffene dabei. Wir waren eine ausserparlamentarische Kommission, die unabhängig agierte und Politikerinnen und Politiker über den aktuellen Stand der Dinge informierte. Das hiess für uns, die Aids- und HIV-Präventionsbemühungen auszuwerten, zu überdenken und allenfalls neu zu positionieren, unter Berücksichtigung aller klinischen, sozialen, technischen und gerichtlichen Aspekte. Immer wieder traten Politikerinnen und Politiker mit konkreten Fragen an uns heran. Zum Beispiel hatte man flüstern gehört, dass HIV-positive Menschen unter guter Therapie nicht mehr infektiös seien – es gab bereits HIV-Fachpersonen, die diese gute Botschaft ihren Patientinnen und Patienten erzählten. Zudem verfügten wir über Daten aus der berühmten Kohortenstudie in der Region Rakai in Uganda. Ausserdem ergaben mehrere Studien, dass bei serodiskordanten Paaren eine massive Risikoreduktion der HIV-Übertragung beobachtet wurde, wenn die HIV-positive Person erfolgreich in Behandlung war, und das unabhängig von einem konsistenten Gebrauch der Kondome.
Was waren die Gründe, dass ausgerechnet die kleine Schweiz mit dem Statement an die Öffentlichkeit ging?
Ja, die kleine Schweiz war eben in Bezug auf die Anzahl der HIV-Infizierten nicht klein, sondern wies europaweit eine hohe Prävalenz auf. Das war ein «Erbe» der Drogenszene und der aktiven Szene von Männern, die Sex mit Männern hatten. HIV war in der Schweiz zu jener Zeit ein grosses Problem und ein grosses Thema. Zweitens hatten wir in der Forschung und Meinungsbildung mit Professor Ruedi Lüthy und Professor Bernard Hirschel zwei führende Persönlichkeiten, die auch international sehr gut vernetzt waren und sind. Hirschel war ein kreativer Geist und überraschte immer wieder mit guten Ideen. Und mit Professor Pietro Vernazza hatten wir einen Forscher und Kommissionspräsidenten, der nachwies, dass im Sperma beziehungsweise in der Vaginalflüssigkeit einer behandelten HIV-positiven Person die Viruslast tief bis nicht mehr nachweisbar war. Wir verfügten also in der Schweiz über überzeugende Daten aus publizierten Kohortenstudien und biologischen Studien. Es war kein Kaffeesatzlesen, sondern uns standen ausgewiesene Daten zur Verfügung. Es ging uns nicht darum, die Ersten zu sein, die mit diesen Daten an die Öffentlichkeit gingen. Wir fällten den Entscheid in einer multidisziplinären Gruppe, angespornt von führenden Forschern und Forscherinnen. Wir wollten den Spekulationen und teilweise falschen Interpretationen einen Riegel schieben und Klarheit darüber schaffen, was stimmte und was nicht – dass es zum Beispiel nicht reicht, die Medikamente ein paar Tage zu nehmen, und schon ist man nicht mehr infektiös. Das Statement war konservativ, also vorsichtig formuliert, wie wir heute wissen. Aber damals schlug es wie eine Bombe ein. Einige Reaktionen waren heftig.
Wie wurde das Statement aufgenommen?
Besonders am Anfang standen einige Stakeholder, unter anderem auch die Aids-Hilfe Schweiz, dem Statement eher skeptisch gegenüber. Ein Vorwurf lautete, wir hätten zwanzig Jahre Aids-Prävention über den Haufen geworfen. Das war selbstverständlich nicht unsere Absicht, sondern wir wollten ein weiteres Mittel zur Prävention bekannt machen und klarmachen, dass nicht bloss das Kondom sicher vor HIV schützt. Und es war uns wichtig, dass darüber geredet wurde, offiziell, nicht spekulativ. Heute wissen wir, dass die Therapie effizienter als das Präservativ ist, das ja auch gelegentlich platzt oder falsch angewendet wird.
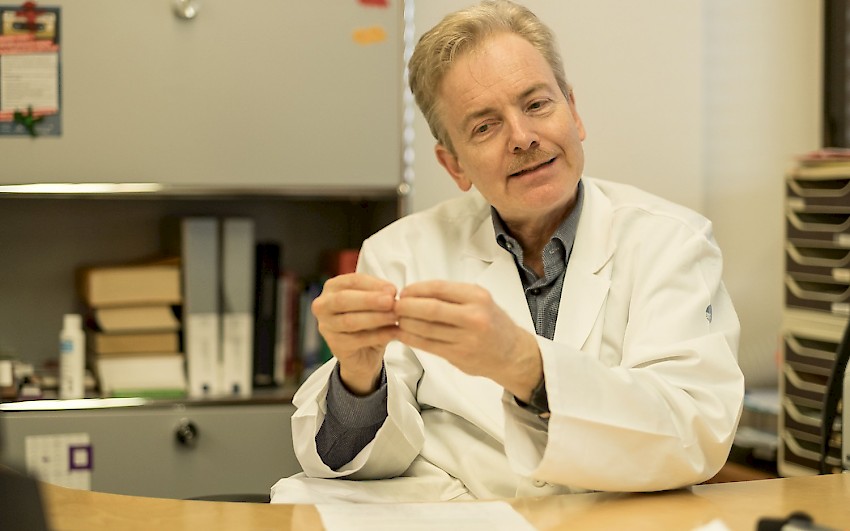
War die EKAF auf die Reaktionen vorbereitet?
Ja, wir waren vorbereitet. Und unser Statement sollte auch ein Anstoss für weitere, gross angelegte Studien sein. Die internationale Vernetzung trug dann auch dazu bei, die Zahlen zu konsolidieren – und zu bestätigen, dass wir recht hatten.
Und heute?
Bis vor zwei, drei Jahren schickten zum Beispiel einige italienische Kolleginnen und Kollegin immer wieder serodifferente Paare (der Mann oder die Frau ist HIV-positiv) mit Kinderwunsch für eine Beratung zu mir in die Schweiz. Natürlich kannten diese Ärztinnen und Ärzte das Swiss Statement und wussten von der Wirksamkeit der Therapie, aber offiziell dazu Stellung zu beziehen, war in Italien nicht opportun. So lag es an mir, diese Paare aufzuklären, ihnen die Angst vor einer Übertragung zu nehmen und ihnen so eine natürliche Schwangerschaft zu ermöglichen. Doch selbst in der Schweiz stosse ich in meiner Tätigkeit als Universitätsdozent immer wieder auf junge Kollegen und Kolleginnen, die das Swiss Statement nicht kennen. Die Botschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lautet heute kurz und bündig: «u = u: undetectable = untransmittable». Das konnten wir 2008 noch nicht so sagen, dazu hatten wir zu wenige Daten. Heute haben wir genügend aussagekräftige, prospektive Studien, wie zum Beispiel die Studien PARTNER 1 und PARTNER 2, und können «u = u» voll und ganz unterschreiben. Diese Nachricht muss nun weitergetragen und auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen verbreitet werden – weltweit. Das wird seine Zeit brauchen, aber es ist wichtig.