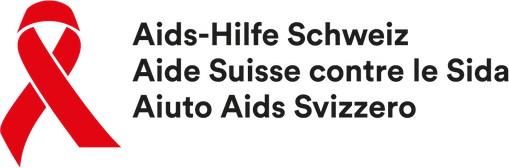Prävention und Risikominderung
Während Chemsex in den Massenmedien häufig unter dem Aspekt der Stigmatisierung und Prohibition Schlagzeilen macht, gibt es ein breites Spektrum an Instrumenten und Initiativen zur Prävention und Risikominderung.
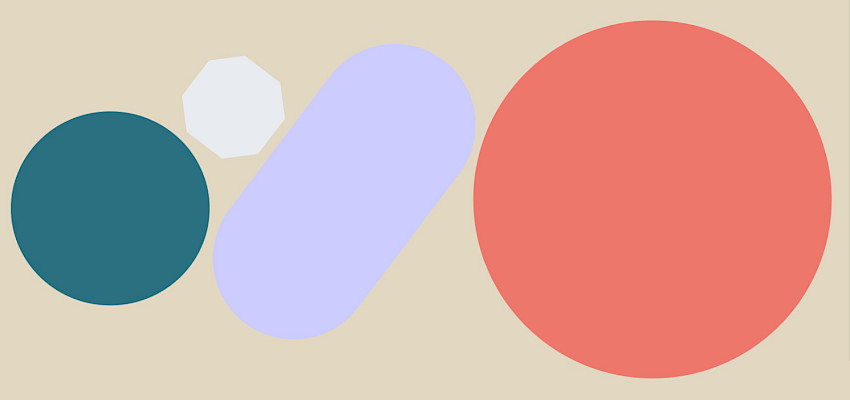
Laure Dasinieres | Juli 2023
«Das Interessante am Ansatz der Risikominderung bei Chemsex ist zunächst einmal, dass damit das Eingeständnis vorausgesetzt wird, dass es diese Praxis gibt, dass sie existiert. Das war in der Medizin nicht immer der Fall.» Dr. Vanessa Christinet kennt das Thema gut: Im Checkpoint der Stiftung Profa in Lausanne, für den sie verantwortlich ist, wurden Sprechstunden und Gesprächsgruppen für Chemsex-Praktizierende eingerichtet, die das Bedürfnis haben, sich helfen zu lassen und nicht allein zu bleiben. Die Frage unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als ob es sie nicht gäbe, wäre im besten Fall eine schuldhafte Blindheit und im schlimmsten Fall eine Gefahr für andere. Laut einer niederländischen Studie lehnen es 21 Prozent derjenigen, die gelegentlich oder regelmässig Chemsex praktizieren, ab, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, weil sie sich stigmatisiert fühlen, eine Atmosphäre des Tabus herrscht, die Fachpersonen nicht genug wissen und sie sich schämen. Ausserdem führt das Schüren des Verbots rund um Chemsex dazu, dass die Verbreitung von Websites und Informationsmaterialien gehemmt wird, die es ermöglichen, sich effektiv über bewährte Praktiken zu informieren. Das Phänomen Chemsex sollte daher ohne Tabus oder falsche Scham unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Was ist gemeint, wenn von Chemsex die Rede ist? Der Begriff wurde in der angelsächsischen Gay-Community geprägt und bezieht sich auf den Gebrauch psychoaktiver Substanzen in einem sexuellen Kontext – mit «chems» werden im Englischen umgangssprachlich illegale Drogen bezeichnet. Obwohl diese Definition allein verschiedene hetero- und homosexuelle Kontexte beschreiben kann, bezieht sich der Begriff Chemsex auf eine Reihe von Praktiken, die vor allem schwule Männer praktizieren und bei denen psychoaktive Substanzen im Rahmen von meist organisierten und geplanten Sexsessions konsumiert werden – man spricht von einem «Chem-Plan». Diese Pläne beinhalten meist Gruppensex und/oder sogenannte «harte» Praktiken (wie Fist-fucking) und können von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. Die dabei verwendeten Substanzen sind meist:
- Stimulanzien: Cathinone (3–MMC,
- 4–MMC (Mephedron), MDPV und PVP), Metamphetamine, Kokain
- Empathogene: MDMA (Ecstasy),
- MDA, MDEA, MBDB
- GHB/GBL
Während Chemsex zunächst vor allem bei über 30-jährigen HIV-positiven Männern, die Sex mit Männern haben (MSM), verbreitet war, scheinen heute immer mehr HIV-negative Jugendliche damit anzufangen, was sowohl auf die explosionsartige Verbreitung von Online-Dating-Apps als auch auf die grössere Verfügbarkeit verschiedener synthetischer Drogen zurückzuführen ist. Angesichts dessen lassen sich die Risiken, die mit Chemsex einhergehen, und die Möglichkeiten, diesen vorzubeugen und sie zu vermindern, besser verstehen. Es gibt zwei komplementäre Ansätze: Safer Sex und Safer Use. Dabei ist zu beachten, dass, wie Marc Marthaler, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Infodrog, erklärt, «die Risikominderung kein Werturteil über den Drogenkonsum fällt, sondern sich durch eine akzeptierende Haltung auszeichnet».
Safer Sex
«Der Zusammenhang zwischen Drogen- wie auch Alkoholkonsum und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) ist epidemiologisch erwiesen», erklärt Vanessa Christinet. In einem Umfeld, in dem oft mehrere Partner involviert sind und, wie Florent Jouinot, Leiter der Westschweizer Koordination der Aids-Hilfe Schweiz, betont, «der Gebrauch von Kondomen alles andere als systematisch ist», sind die Risiken höher. Diese lassen sich vermindern, indem man:
- die PrEP anwendet. «PrEP ist die sicherste und wirksamste Strategie, um sich vor HIV zu schützen», sagt Florent Jouinot. «Für mich ist das ein wesentlicher Aspekt, den ich systematisch anspreche», bestätigt Vanessa Christinet.
- sich impfen lässt (Hepatitis A und B, HPV).
- sich regelmässig testen lässt (HIV, Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien, Hepatitis C).
- die PEP anwendet, wenn es zu einer potenziellen HIV-Exposition gekommen ist. Je schneller die PEP verabreicht wird, desto wirksamer ist sie. Es ist daher ratsam, die nächste medizinische Notaufnahme aufzusuchen, um sich eine PEP verschreiben zu lassen. Die Kosten für die PEP können von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Grundversicherung) übernommen werden.
- beim Fisten Handschuhe trägt und Sextoys und Analeinläufe reinigt und desinfiziert, um eine Hepatitis-C-Infektion zu verhindern.
In Bezug auf die STI-Prävention weist Vanessa Christinet zudem darauf hin, dass einvernehmlicher Sex «im Zusammenhang mit Chemsex problematisch sein kann». In der Tat ist eine Person, die betrunken ist, die Drogen nimmt oder die schläft, anfälliger dafür, ein Opfer von Missbrauch zu werden, der als sexuelle Gewalt gilt. Nicht zuletzt aus diesem Grund empfiehlt Florent Jouinot, dass Chemsex nur in Begleitung von Vertrauenspersonen praktiziert wird, die auf missbräuchliches oder gewalttätiges Verhalten reagieren können.
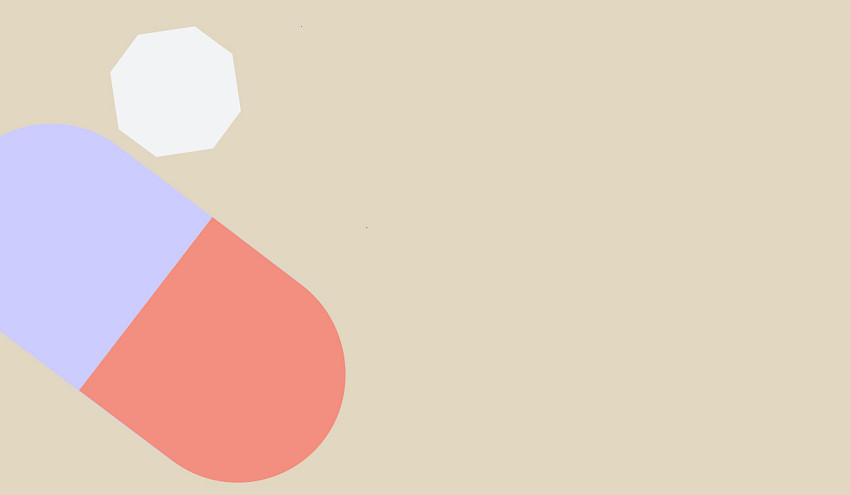
Safer Use
Es empfiehlt sich also, für einen sicheren Rahmen zu sorgen und die Personen, mit denen man Chemsex praktiziert, zu kennen und sich auf sie verlassen zu können – nicht zuletzt, um die Risiken des Drogenkonsums zu mindern. Florent Jouinot erinnert daran, dass kein Drogenkonsum harmlos ist, und betont: «Es ist wichtig, Freunde zu haben, die in der Lage sind, sich um einander zu kümmern, auf Probleme zu reagieren und gegebenenfalls um Hilfe zu rufen.»
Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum zu mindern, ist es zudem wichtig:
- gut Bescheid zu wissen über die verwendeten Substanzen, ihre Dosierung, ihre Wirkung und ihre Wechselwirkungen mit anderen Drogen und Medikamenten. Die Website Know-drugs.ch bietet zuverlässige Informationen zu diesem Thema und listet auch Warnungen über Produkte auf, die im Umlauf sind. Marc Marthaler fügt hinzu: «Es gibt in Zürich ein Drug-Checking-Angebot, das sich explizit an Chemsex-Praktizierende richtet.»
- bewährte Praktiken und Hygieneregeln einzuhalten, wenn man der Organisator des «Chem-Plans» ist. Es empfiehlt sich z. B., den Teilnehmern eine Tabelle zur Verfügung zu stellen, auf der sie die von ihnen eingenommenen Substanzen, den Zeitpunkt der Einnahme und die Dosierung notieren, um Überkonsum und Überdosierungen zu vermeiden. Die von Dr. Gay herausgegebene Broschüre «Safer Chemsex» enthält zu diesem Thema zahlreiche wichtige Ratschläge.
- die Verabreichungsmethoden gut zu kennen, insbesondere beim «Slammen», d. h. beim Spritzen des Produkts, da hier das Risiko einer Überdosis, aber auch von Infektionen höher ist. Dr. Gay bietet auf der Website und in der Broschüre «Slam Chem Sex» eine Reihe von Ratschlägen an.
- ein paar wichtige Massnahmen zur Selbstfürsorge einzuhalten: Mischkonsum vermeiden, Essen und Trinken nicht vergessen, sich frisch machen, sich ausruhen.
- sich auch um andere zu kümmern. Solidarität ist zentral, und es ist wichtig, einem Freund, der in Schwierigkeiten ist, zu helfen und die Notrufnummer 144 im Hinterkopf zu haben, unter der man telefonisch Hilfe bekommt.
Personen, die in therapeutischer oder präventiver HIV-Behandlung sind, müssen besonders wachsam sein. Wie eine Studie zeigt, wird die Medikamenteneinhaltung bei der Einnahme von Substanzen – insbesondere von GHB/GBL, Kokain, Amphetamin und Metamphetamin – weniger stark befolgt.
Der Begriff wurde in der angelsächsischen Gay-Community geprägt und bezieht sich auf den Gebrauch psychoaktiver Substanzen in einem sexuellen Kontext – mit «chems» werden im Englischen umgangssprachlich illegale Drogen bezeichnet.
In diesem Fall ist es ratsam, auf seinem Telefon eine Erinnerung einzurichten und darauf zu achten, dass man einen ausreichenden Vorrat an Medikamenten mit sich führt, falls die Sitzung länger dauert als geplant. Vorsicht ist auch geboten, da es zu Wechselwirkungen zwischen HIV-Therapien und bestimmten psychoaktiven Substanzen kommen kann. Um diese möglichen Wechselwirkungen im Einzelnen und von Fall zu Fall zu überprüfen, bietet der französische Verband Actions Traitements auf seiner Website eine Medikamenten-Wechselwirkungs-Tabelle, mit der die Wechselwirkungen zwischen einer HIV- oder HCV-Therapie und anderen Medikamenten, diversen Freizeitdrogen sowie bestimmten Pflanzen, die in der Phytotherapie verwendet werden, überprüft werden können.
Von der Chemsex-Party zum Abstieg in die Hölle
«Bei manchen Chemsex-Praktizierenden reicht die Risikominderung in Bezug auf STI und Drogen aus, und es gelingt ihnen, regelmässig an Sexsessions teilzunehmen – vielleicht weil sie nebenbei starke emotionale Bindungen zu Familie und Freunden haben und sich für ihre Arbeit interessieren. Aber bei anderen kann Chemsex zu einem regelrechten Abstieg in die Hölle führen, manchmal ziemlich schnell», erklärt Vanessa Christinet. «Häufig ist der Konsum eine Reaktion auf negative Gefühle wie Depressionen, Angst und Frustration», bestätigt Patrice Aiello, Krankenpfleger und Peer-Helper beim Checkpoint der Stiftung Profa in Lausanne. In der Tat kann die Kombination von Drogen und Sex auf einem suchtgefährdeten Terrain und bei psychischen Anfälligkeitsfaktoren wie mangelndem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, Unwohlsein oder auch Schwierigkeiten mit der eigenen Sexualität dramatische Folgen haben: Vereinsamung, Isolation, Arbeitsplatzverlust, Unfähigkeit, Sex ohne Substanzen zu haben, Depressionen. «Bevor ich Hilfe suchte, wurde mir bewusst, dass Chemsex alle Aspekte meines Lebens beeinflusste», sagt Patrice Aiello, der selbst durch diese Höllenfahrt gegangen ist. «Im Moment selbst ist das Chem super, es entschärft alle negativen Gefühle. Aber sobald man aufhört, wird es noch schlimmer. Die Depressionen und Ängste kehren zurück, und die Folgen in Form von sozialer und familiärer Isolation sind schrecklich. Und um dem entgegenzuwirken, konsumiert man wieder.»
Lässt sich diese dramatische Abwärtsspirale verhindern? Auch wenn es nicht immer leicht ist, sich gewisse Dinge bewusst zu machen, ruft Florent Jouinot Chemsex-Praktizierende dazu auf, bewusst zu konsumieren und regelmässig Bilanz zu ziehen, indem man sich Fragen über seine Praktiken stellt:
- Habe ich die Häufigkeit des Konsums erhöht?
- Habe ich die Dosis erhöht?
- Hat mein Konsum Auswirkungen auf andere Bereiche meines Lebens?
- Kann ich noch Sex ohne Substanzen haben?
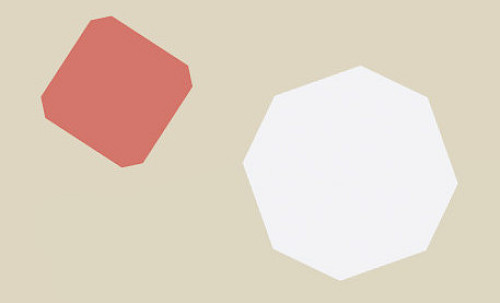
Clara Feteanu, Psychiaterin und Psychotherapeutin FMH am Checkpoint der Stiftung Profa in Lausanne, weist auf verschiedene Warnsignale hin, die dazu führen können, sich Hilfe zu holen: «Ich denke insbesondere daran, dass man beim Slam eine höhere Intensität sucht, um eine stärkere Wirkung zu erzielen. Zudem verbringt man immer mehr Zeit damit, an den Konsum zu denken, ihn vorzubereiten und sich von ihm zu erholen. Und dann gibt es noch die Auswirkungen, die der Konsum auf das Leben der Person hat, insbesondere in Bezug auf die Finanzen – immer mehr Geld fliesst in den Chemsex und die Substanzen –, aber auch auf die Beziehungen: Die Person schafft es nicht mehr, ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Angehörigen, ihrer Familie oder am Arbeitsplatz nachzukommen.» Zu dieser Fokussierung des Lebens auf den Chemsex kommt hinzu, dass sich die physische und psychische Gesundheit verschlechtert. Angesichts dieses Bündels von Anzeichen können betroffene Chemsex-Praktizierende in Checkpoints und anderen Zentren für sexuelle und allgemeine Gesundheit multidisziplinäre Hilfe in unterschiedlicher Form finden: Beratungen bei einem Arzt, einem Psychiater und/oder einer spezialisierten Fachperson Gesundheit, Beratung durch einen Peer-Helper, Psychotherapie zu den Themen Sucht und sexuelle Gesundheit, Gesprächsgruppen usw. «All diese Angebote ergänzen sich. Was man in der Gruppe, unter Gleichaltrigen, bespricht, unterscheidet sich von dem, was man in einer Beratung bespricht», sagt Clara Feteanu. «Es ist eine Bereicherung, dass man sich an diese verschiedenen Personen wenden kann.»
Wenn Chemsex zum Problem wird, besteht der beste Ansatz darin, ihn besser zu verstehen, anzusprechen und zu entstigmatisieren.