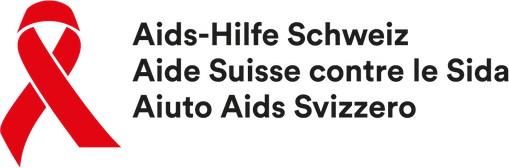«Nicht alle haben die gleichen Gesundheitschancen»
Samira Marti, Nationalrätin der SP, forderte 2019 mit einem Postulat den Bundesrat auf, einen Bericht über die Gesundheit von Lesben, Schwulen und Bisexuellen zu erstellen. 2022 wurde der Bericht vom Bundesrat verabschiedet. Wie erwartet, muss sich die Schweiz sputen, wenn sie das Gesundheitssystem für alle Menschen gleich gut zugänglich und inklusiv machen will.

Samira Marti
ist Ökonomin und SP-Nationalrätin des Kantons Basel-Landschaft. Sie setzt sich aktiv für die Gleichstellung der Geschlechter ein, für eine aktive Friedenspolitik, für den Klima- und Umweltschutz wie auch für die Rechte von Minderheiten im globalen Süden.
Interview mit Samira Marti: Brigitta Javurek
Die Schweiz hat ein gut ausgebautes und vielfältiges Gesundheitssystem. Es kostet viel, bietet auch viel. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden?
Ja, damit bin ich einverstanden. Gesundheit ist ein hohes Gut und darf etwas kosten. Mühe habe ich aber damit, dass immer ein grösserer Teil der Gesundheitskosten via Kopfsteuern (Krankenkassenprämien) finanziert wird: Die Professorin und die Reinigungskraft bezahlen gleich viel. Das ist unsozial.
Was waren die Beweggründe für Ihr Postulat 2019 an den Bundesrat, einen Bericht über die Gesundheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen (LGB) erstellen zu lassen?
Laut internationalen Studien weisen LGB – insbesondere Frauen – im Vergleich zur Restbevölkerung einen schlechteren Gesundheitszustand auf und haben teilweise auch einen erschwerten Zugang zu Pflegeinstitutionen. Um diese Missstände politisch anzugehen, brauchen wir entsprechende Datenauswertungen für die Schweiz. Dafür war mein Postulat gedacht.
Warum fehlt in dem Postulat das T (trans Menschen)?
Transmenschen sind im Postulat nicht erwähnt, weil es dazu nicht viele Zahlen gab. Deshalb wurde in Absprache mit dem Transgender Network entschieden, das T wegzulassen, weil wir sonst Gefahr liefen, dass die Analyse zu lückenhaft würde. Mein Postulat verlangte ja, dass die bereits erfassten Daten umfangreich ausgewertet werden. Die sexuelle Orientierung ist im Fragenkatalog des Bundes erfasst, die Geschlechtsidentität leider nicht. Die von der Hochschule Luzern durchgeführte Zusatzstudie hat nun allerdings trans und/oder non-binäre Menschen mitberücksichtigt, weshalb zumindest ein erster Überblick über die Gesundheit dieser Bevölkerungsgruppe nun möglich wurde. In Zukunft sollten bei Datenerhebungen die sexuelle Orientierung und die Geschlechts-identität immer miterfasst werden.
Waren Sie überrascht, dass der Bundesrat Ihrem Postulat wohlgesonnen war?
SP-Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset hat sich stark für das Postulat eingesetzt. Die bundesrätliche Empfehlung zur Annahme hat später geholfen, im Rat eine Mehrheit zu finden. Als linke Parlamentarierin gehört es zum politischen Alltag, in der Minderheit zu sein. Umso mehr freue ich mich über solche Erfolge.
Sie fordern gesundheitliche Chancengleichheit für alle in der Schweiz lebenden Menschen. Was beinhaltet das?
Es bedeutet, dass alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung und unseren Pflege-institutionen haben, unabhängig von sozialen und finanziellen Faktoren. Wenn strukturelle Diskriminierungen festgestellt werden, braucht es ausreichende Mittel zu deren Bekämpfung. Und wenn strukturelle Gesundheitsrisiken erkennbar sind, müssen spezifische Massnahmen ergriffen werden; bei LGBT-Personen gilt das insbesondere in den Bereichen Suizidprävention, sexuelle Gesundheit und Sucht.
Nationale Daten zur Gesundheit von LGBT-Personen sind in der Schweiz rar. Wie steht die Schweiz im europäischen Vergleich da?
Im Vergleich zu fast allen unseren europäischen Nachbarn haben wir in der Schweiz die Gesundheitssituation der LBGT-Personen bisher nicht erforscht. Das erklärt auch, warum bisher fast nichts für queere Personen getan wurde.
Die Hochschule Luzern erstellte in der Folge einen Forschungsbericht. Dieser wurde Ende 2022 vom Bundesrat verabschiedet. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht?
Der Bericht bestätigt, was die LGBT-Dachverbände schon seit Jahren sagen: Nicht alle in der Schweiz lebenden Menschen haben die gleichen Gesundheitschancen. Es gibt klare Unterschiede zwischen heterosexuellen Cis-Personen und LGBT-Personen; letztere leiden deutlich häufiger an Depressionen. Zudem sind die erhöhte Suizid- und Suchtgefährdung und die psychische Gesundheit auffällig. Auch der Zugang zu den Gesundheitsinstitutionen ist erschwert, insbesondere für trans und/oder non-binäre Personen: Fast ein Drittel berichtet, dass sie in den letzten zwölf Monaten im Rahmen der Gesundheitsversorgung Diskriminierung oder Gewalt erlebt haben. Wichtig zu betonen ist aber auch: Natürlich sind nicht die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität der Grund dafür, sondern die damit verbundene Stigmatisierung und Diskriminierung.
Der Bericht zeigt eine gesundheitliche Ungleichheit zwischen LGBT-Personen und der übrigen Schweizer Bevölkerung auf. Wie geht es nun weiter?
Nun gilt es, die entdeckten Missstände zu beheben. Der Bundesrat muss handeln. Es braucht spezifische Massnahmen, aber es müssen auch alle bestehenden Angebote in der Gesundheitsförderung, Prävention und Behandlung LGBT-inklusiv gestaltet werden. Wichtig ist es, dass die lokalen und nationalen Organisationen dabei einbezogen werden. Sie haben aufgrund der Untätigkeit der staatlichen Institutionen in den letzten Jahren die Lücken gefüllt und viel Know-how erarbeitet.
Was sollte rasch angegangen und umgesetzt werden?
Gegen Diskriminierung und Gewalt vorzugehen, muss als gesundheitsrelevanter Aspekt miteinbezogen werden. Der Bundesrat soll den Nationalen Aktionsplan gegen Diskriminierung so schnell wie möglich erarbeiten und umsetzen.
Gibt es Widerstände gegen die Umsetzung?
Ich rechne fest damit. Das Postulat wurde von der SVP bekämpft. Ich nehme leider an, dass das so bleiben wird.
Wie sieht die Gesundheitsvorsorge 2030 für LGBT-Personen in der Schweiz aus?
Hoffentlich sind wir dann schon ein gutes Stück weiter und nicht mehr an den Datenanalysen, sondern bei konkreten Massnahmen. Alle Angebote sollten inklusiv sein und für spezifische Risiken sollte es entsprechende Prävention und Sensibilisierung und niederschwellige Zugänge zur Gesundheitsversorgung geben.
Das Interview mit Samira Marti wurde schriftlich geführt.
Was ist ein Postulat?
Ein Postulat beauftragt den Bundesrat, zu prüfen und zu berichten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorgelegt oder eine Massnahme getroffen werden muss. Ein Postulat kann von einem Ratsmitglied, einer Fraktion oder einer Kommissionsmehrheit eingereicht werden. Der Bundesrat stellt in der Regel bis zum Beginn der nächsten ordentlichen Session nach dem Einreichen eines Postulates Antrag auf dessen Annahme oder Ablehnung. Wird das Postulat vom Rat, in dem es eingereicht wurde, angenommen, wird es damit an den Bundesrat überweisen. Lehnt der Rat das Postulat hingegen ab, ist es gescheitert.
Was ist ein Postulat?
Ein Postulat beauftragt den Bundesrat, zu prüfen und zu berichten, ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorgelegt oder eine Massnahme getroffen werden muss. Ein Postulat kann von einem Ratsmitglied, einer Fraktion oder einer Kommissionsmehrheit eingereicht werden. Der Bundesrat stellt in der Regel bis zum Beginn der nächsten ordentlichen Session nach dem Einreichen eines Postulates Antrag auf dessen Annahme oder Ablehnung. Wird das Postulat vom Rat, in dem es eingereicht wurde, angenommen, wird es damit an den Bundesrat überweisen. Lehnt der Rat das Postulat hingegen ab, ist es gescheitert.