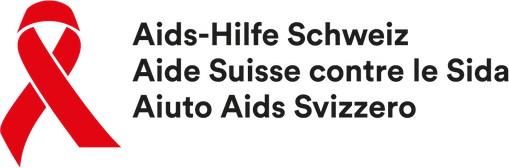LGBT – die Politisierung von vier Buchstaben
Mitte März hat das Europaparlament die Europäische Union zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen erklärt. Die Erklärung kann als Reaktion auf Resolutionen gegen eine «LGBT-Ideologie» in etwa hundert polnischen Gemeinden gewertet werden. Doch was ist mit LGBTIQ eigentlich gemeint, und gibt es eine solche gemeinsame Ideologie überhaupt? Unser nicht abschliessendes ABC klärt auf und umreisst einige Spannungsfelder.


Nathan Schocher
Leiter Programm Menschen mit HIV der Aids-Hilfe Schweiz.
NATHAN SCHOCHER | April 2021
Die LGBT-Bewegung ist eine wacklige Koalition unterschiedlicher sozialer Bewegun-gen gegen gemeinsame Feinde. Herrschte Anfang der 80er-Jahre noch Zersplitterung vor, bewirkte die Aidskrise eine Solidarisierung gegen die erstarkte Homophobie in der Gesellschaft. Mit dem vermehrten Einsatz des Begriffs LGBT ab 1988 begann eine weltweite Erfolgsgeschichte; in vielen Ländern, so auch der Schweiz, gelang es der Bewegung in den vergangenen Jahrzehnten, die rechtliche und gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTs entscheidend zu verbessern. Das Label vermag es offenbar, Anliegen zu bündeln, die von verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten geteilt werden. Als Akronym für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten hat LGBT allerdings das Problem, dass es nicht abschliessend sein kann. Um diese Offenheit für verwandte Communitys zu symbolisieren, wird manchmal auch die Schreibweise LGBT+ verwendet.
Politisch wird LGBT-Freundlichkeit mittlerweile oft als Differenzierungsmarker eingesetzt. Vertreter westlicher Länder tragen sie oft wie eine Auszeichnung vor sich her, mit der man sich von «rückständigeren» Ländern unterscheide. Das geht bis zur selbstgerechten Haltung, LGBT-Feindlichkeit existiere in westlichen Ländern nicht und sei höchstens ein Problem zugewanderter Communitys. Auf der Gegenseite dienen LGBT-Rechte hingegen als Schreckgespenst und Symptom einer dekadenten westlichen Zivilisation, in der Individualismus und Hedonismus religiöse und Familienwerte ersetzt haben. Diese plakative Entgegensetzung hat unter anderem negative Folgen für die HIV-Prävention. Die Kriminalisierung von LGBTs und der Aufklärung über LGBT-Themen erschwert zielgerichtete Information zu und die Behandlung von HIV massiv.
Das Label vermag es offenbar, Anliegen zu bündeln, die von verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten geteilt werden. Als Akronym für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten hat LGBT allerdings das Problem, dass es nicht abschliessend sein kann.
Vielleicht ist es deshalb trotzdem sinnvoll, dem Begriff LGBT eine gewisse Instabilität und auch Unabgeschlossenheit zu belassen und ihn weiterzuverwenden. Denn zu starre Identitätskategorien gehen am realen Leben vorbei. Und wenn Bemühungen um sexuelle Gesundheit erfolgreich sein sollen, dann müssen sie im realen Leben Anwendung finden und umgesetzt werden.
A wie asexuell: Asexualität bezeichnet das Fehlen von sexuellem Interesse oder Verlangen. Der Begriff stellt für die unter LGBT versammelten sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten eine Herausforderung dar, da er gerade die Abwesenheit von sexuellen Bedürfnissen thematisiert. Er passt aber insofern dazu, indem er ebenfalls eine Abweichung von einer dominierenden gesellschaftlichen Norm bezüglich Sexualität darstellt, nämlich der Norm, überhaupt sexuelle Bedürfnisse zu haben. Damit bringt die Orientierung eine wichtige Kritik an sexuellem Leistungsdruck und heteronormativen Lebensformen, die auch in LGBT-Kreisen präsent sind, zum Ausdruck.
B wie bisexuell: Bisexualität beschreibt die sexuelle Anziehung sowohl zu Männern als auch Frauen. Bisexuelle geniessen wenig Sichtbarkeit in der LGBT-Bewegung. Sie sehen sich wechselweise dem Verdacht, eigentlich doch schwul beziehungsweise lesbisch zu sein, und dem Vorwurf der Kollaboration mit dem System ausgesetzt. Neuerdings erwächst der Bisexualität Konkurrenz vom Begriff der Pansexualität. Dieser erweitert das Spektrum der Bisexualität auf die Geschlechtsidentitäten zwischen männlich und weiblich. Sowohl Bi- als auch Pansexuelle haben mit dem Vorurteil der sexuellen Unersättlichkeit zu kämpfen, obwohl die Offenheit bezüglich des Geschlechts ja über die Anzahl der gewünschten Partner_innen nichts aussagt.
G wie gay: In den 60er-Jahren begann sich bei schwulen Männern im Englischen der Begriff «gay» gegenüber den ungeliebten Begriffen «homosexual» oder «homophile» durchzusetzen. Der Widerstand gegen die Räumung der New Yorker Stonewall-Bar am 27. Juni 1969 gilt als Geburtsstunde der Gay Liberation, der Schwulenbewegung. Hatte vorher die Homophilen-Bewegung mit grosser Zurückhaltung für die Entkriminalisierung schwuler Lebensweisen plädiert, trug das Ereignis Stonewall diesen Kampf auf die Strasse. Als Folge von Stonewall sind rund um die Welt die Pride-Märsche entstanden, an denen die LGBT-Community laut und sichtbar gegen Diskriminierung kämpft. Historisch nehmen an diesen Prides schwule Männer eine dominante Rolle ein, was ihnen innerhalb der LGBT-Community gelegentlich den Vorwurf einträgt, die Pride-Veranstaltungen für schwule Anliegen zu okkupieren.
I wie intersexuell: Intersexuelle werden mit sogenannt uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren. Sie fordern, dass nicht ohne Einbezug der betroffenen Person kurz nach der Geburt bereits geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen werden. Exponent_innen der LGBT-Bewegung führen die Existenz von Intersexualität gern als Beweis dafür an, dass es auf biologischer Ebene mehr als zwei Geschlechter gibt. Als Menschen, die ungefragt mit den Folgen von geschlechtsangleichenden Operationen leben müssen, können Intersexuelle allerdings mit der queeren Lust an der Geschlechtervielfalt nicht so viel anfangen. Im Gegenzug fallen ihre spezifischen Forderungen häufig unter den Tisch.
L wie lesbisch: Gesellschaftlich im Vergleich zu Schwulen weniger ausdrücklich kriminalisiert, kämpfen Lesben seit jeher darum, wahr- und ernst genommen zu werden. Auch innerhalb der LGBT-Bewegung wird dieser Kampf um Wahrnehmung immer wieder geführt. Als Motor und Zankapfel zugleich fungiert der Feminismus. Lesben waren und sind ein aktiver Teil der Frauenbewegung. Trotzdem gab es gerade in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren Feministinnen, die sich bewusst von der lesbischen Community abgrenzen wollten. Das Verhältnis zur Schwulenbewegung ist ebenfalls nicht spannungsfrei, profitieren Schwule doch von der sogenannten patriarchalen Dividende; das heisst, sie geniessen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht Privilegien, die Frauen vorenthalten werden.
Q wie queer oder questioning: Wird oft dem Akronym LGBT angefügt, um als Sammelbegriff zu dienen für Identitäten, die von den vorangestellten Buchstaben nicht eingefangen werden. Dies eröffnet aus zwei Gründen ein Spannungsfeld: Erstens hat queer im Englischen seine abwertende Bedeutung im Sinne von «seltsam, suspekt» nicht komplett abgelegt. Zweitens verweist die Zweitbedeutung questioning auf die kritische, aktivistische Bedeutung von queer: etwas «queeren» im Sinn von «eine Ordnung stören», «eine Norm infrage stellen», «eine Regel brechen». Das macht den Begriff zum Störfaktor der Kategorisierung anstelle einer bloss zusätzlichen Kategorie.
T wie trans*: Trans – der Gegenbegriff ist cis – benennt die Identifizierung mit einem anderen als dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Anders als die drei Buchstaben LGB steht das T für eine von der Norm abweichende Geschlechtsidentität und nicht für eine sexuelle Orientierung. Ein grosser Erfolg der Trans-Bewegung ist insbesondere der Abbau juristischer und medizinischer Hürden zu geschlechtsangleichenden Massnahmen. In den letzten Jahren haben innerhalb des Trans-Spektrums nichtbinäre Menschen, die sich zwischen oder ausserhalb der Geschlechterbinarität positionieren, an Sichtbarkeit gewonnen. Ihr Kampf um Anerkennung hat es jedoch in einer Welt, die bis ins Detail entlang der Achse männlich/weiblich organisiert ist, schwer. Forderungen sind etwa ein dritter Geschlechtseintrag, die Verwendung neutraler Pronomen und Anredeformen oder institutionelle Anpassungen wie zum Beispiel genderneutrale Umkleiden, Toiletten etc. Medial werden diese Forderungen oft aufgegriffen, um die LGBT-Bewegung gänzlich als extremistisch zu diskreditieren. Das Thema trans* stellt die Solidarität aber auch innerhalb der LGBT-Bewegung immer wieder auf eine Belastungsprobe: So gibt etwa die Inklusion von Transmännern in schwule und von Transfrauen in lesbische Räume Anlass zu Diskussionen.
Politisch wird LGBT-Freundlichkeit mittlerweile oft als Differenzierungsmarker eingesetzt. Vertreter westlicher Länder tragen sie oft wie eine Auszeichnung vor sich her, mit der man sich von «rückständigeren» Ländern unterscheide. Das geht bis zur selbstgerechten Haltung, LGBT-Feindlichkeit existiere in westlichen Ländern nicht und sei höchstens ein Problem zugewanderter Communitys.