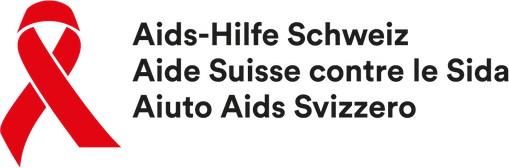Die Crux mit den «unsichtbaren Frauen»
Noch immer sind Frauen in medizinischen Studien untervertreten. Gerade bei der Erfassung von Nebenwirkungen, etwa von HIV-Medikamenten, kann dies zu gefährlichen Lücken führen. Dennoch lässt sich das Problem der «unsichtbaren Frauen» nicht nur auf die Hersteller schieben – sondern ist nicht zuletzt auch ein Resultat fehlender Vereinbarkeit von Beruf, Alltag und Studienteilnahme.

Seraina Kobler | Oktober 2021
Warum frieren Frauen oft im Büro? Weil die gängige Formel für die optimale Raumtemperatur für Männer in den Vierzigern berechnet wurde – und nicht für Frauen, die einen langsameren Stoffwechsel haben. Warum warten Frauen meist länger vor Toiletten als Männer? Weil sie länger brauchen oder mit komplizierteren Reissverschlüssen und Strümpfen hadern. Denn für die durchschnittliche Klobelegung wurde das Sitzverhalten der Männer berechnet. Weshalb erreichen Frauen die Waren in Supermarktregalen oft nicht gut? Sie ahnen es: weil diese von der Höhe her für einen durchschnittlich grossen Mann konzipiert wurden. In ihrem Buch «Unsichtbare Frauen» hat die Journalistin Caroline Criado-Perez verschiedenste alltägliche Aha-Momente skizziert, die zum Schluss vor allem eins nahelegen: Unsere Welt ist von Männern für Männer entworfen – und ignoriert somit über die Hälfte der Bevölkerung. Bezogen auf die Datenerhebung trägt dieses Phänomen den Namen Gender-Data-Gap oder auch Geschlechter-Datenlücke. Entstanden ist der Begriff in Zusammenhang mit den Genderstudies, die in den letzten Jahren vertieft auf Situationen aufmerksam machten, in denen Frauen institutionell benachteiligt sind.
Männer sind in medizinischen Studien noch immer die Norm
Wenn es im Büro zu kalt ist, kann mit einem warmen Pullover Abhilfe geschaffen werden. Anders sieht es aus, wenn etwa Ihre körperlichen Symptome in einer Notfallsituation unterschätzt werden, etwa weil diese sich von den männlichen unterscheiden. Eins der bekanntesten Beispiele dafür ist ein Herzinfarkt, der sich durch Bauch- und Rückenschmerzen äussert statt durch ein Stechen in der Brust. In den letzten Jahren wurden Forschungsprojekte angestossen und diverse neue Weiterbildungsangebote geschaffen, um das medizinische Fachpersonal besser zu sensibilisieren. Schwieriger ist es, Frauen in medizinische Studien für die Zulassung von Medikamenten einzubinden. Dennoch zeigt ein Blick in die Geschichte, dass sich seit den 1960er-Jahren viel getan hat. Damals erschütterte der Contergan-Skandal Deutschland, die Schweiz und Europa und wurde zu einer der grössten Tragödie in der Anwendung von Medikamenten: Ein Beruhigungsmittel für schwangere Frauen kam auf den Markt, das in den darauffolgenden Jahren bei Tausenden von Kindern zu Missbildungen und zum Tod führten. Zuvor war der Wirkstoff einzig an Tieren getestet worden.
Der durchschnittliche Studienteilnehmer ist Mitte 30, 85 Kilo schwer und männlich. Die Folge davon ist, dass sich Medikamentenstudien und medizinische Forschung an der männlichen Gesundheit orientieren – mit diversen Folgen für die Frauengesundheit. Etwa wenn es darum geht, Nebenwirkungen eines Medikaments zu erfassen.
«Dennoch greift es zu kurz, nur die Hersteller verantwortlich zu machen», sagt Braun. «Dort hat man erkannt, dass Frauen eine eigene Population sind.» Und so wurde in den letzten Jahren viel unternommen, um in den Studien die ungleiche Verteilung auszugleichen.
Seither haben Industrie und Gesetzgeber hinzugelernt, und die Sicherheitsprüfungen wurden massiv verschärft. Dennoch werden in der Medizin die weiblichen Bedürfnisse noch immer nicht genügend erkannt. Das liegt auch daran, dass in der Forschung meist Männer als Norm angenommen werden. Der durchschnittliche Studienteilnehmer ist Mitte 30, 85 Kilo schwer und männlich. Die Folge davon ist, dass sich Medikamentenstudien und medizinische Forschung an der männlichen Gesundheit orientieren – mit diversen Folgen für die Frauengesundheit. Etwa wenn es darum geht, Nebenwirkungen eines Medikaments zu erfassen. Denn Frauen haben mehr Fettgewebe im Körper und weniger Muskelmasse als Männer. Ihr Wasseranteil ist geringer. Der Darm arbeitet langsamer. Geschlechtshormone beeinflussen den Stoffwechsel. Medikamente bleiben länger im Körper. Für den Weg durch den Verdauungstrakt braucht eine Tablette bei Frauen doppelt so lange. In der Folge treten bei ihnen häufiger unerwünschte Nebenwirkungen auf. In manchen Fällen kann es sogar lebensgefährlich sein, wenn ein Medikament nur an Männern getestet worden ist.
Schwierige Handhabung bei «First Line»-Medikamenten
Dies zeigt sich auch bei Studien zu HIV-Medikamenten. Da von den 16 700 Personen, die in der Schweiz mit der Krankheit leben, Frauen nur etwa 20 Prozent ausmachen, ist auch die Gruppe potenzieller Studienteilnehmerinnen kleiner. Dominique Laurent Braun, Oberarzt mit erweiterter Verantwortung am Universitätsspital Zürich, kennt die Thematik. Bei der Kombination von TAF/FTC mit einer dritten Substanz gibt es zum Beispiel Personen die unter dieser Therapie stark an Gewicht zunehmen. Um einen geschlechtsspezifischen Effekt studieren zu können, wurde eine Studie durchgeführt, die den Fokus spezifisch auf schwarzafrikanische Frauen legte. In dieser Studie gelang es, zu 59 Prozent Frauen einzuschliessen, und es zeigte sich, dass die Gewichtszunahme vor allem bei Frauen auftrat. Zuvor war dieser Geschlechts- und Ethnizität-spezifische Effekt in den Zulassungsstudien nicht klar ersichtlich gewesen. Gerade wenn es sich wie in diesem Fall um ein sogenanntes «First Line»-Medikament handelt, also um einen Wirkstoff, der als erste Wahl zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung angesehen wird, kann dies problematisch werden – da man Tausende, Hunderttausende von Frauen auf das Medikament setzt. Die oben erwähnte Studie mit vorwiegend Einschluss von Frauen führte im Fall von TAF/FTC dazu, dass die WHO das Medikament nicht mehr explizit als erste Therapie auf dem afrikanischen Kontinent empfahl, weil die Gewichtszunahme bei den Betroffenen zu Diabetes und hohem Blutdruck führen kann.
«Dennoch greift es zu kurz, nur die Hersteller verantwortlich zu machen», sagt Braun. «Dort hat man erkannt, dass Frauen eine eigene Population sind.» Und so wurde in den letzten Jahren viel unternommen, um in den Studien die ungleiche Verteilung auszugleichen.
Komplexe Wechselwirkungen führen zu tiefen Zahlen
«Dennoch greift es zu kurz, nur die Hersteller verantwortlich zu machen», sagt Braun. «Dort hat man erkannt, dass Frauen eine eigene Population sind.» Und so wurde in den letzten Jahren viel unternommen, um in den Studien die ungleiche Verteilung auszugleichen. Dennoch spielen verschiedene Faktoren zusammen, die es erschweren, mehr weibliche Probandinnen einzubinden. So müssen etwa Frauen für die Dauer einer Studie, die meistens zwei Jahre beträgt, zwei sichere Verhütungsmethoden nutzen. Was oft heisst: Kondome plus Spirale oder Antibabypille. Dies zu einem Zeitpunkt, da sie unter der HIV-Therapie mit der Viruslast nicht nachweisbar sind und nicht doppelt verhüten müssten. Doch Rechtsfälle in Bezug auf Komplikationen bei Schwangerschaften kann sich keine Firma leisten. Schon gar nicht bei einem Medikament, das oft Milliarden von Franken kostet, bis es auf den Markt kommt. So wurde etwa das HIV-Medikament Dolutegravir in sogenannten Post-Marketing-Studien und Kohorten weiter studiert, um Daten zu dem Nutzen oder möglichen Risiken in der Schwangerschaft analysieren zu können. Aus den Zulassungsstudien gab es noch keine Daten zu Frauen und Schwangerschaft. In einer Geburtenkohorte gab es ein Anzeichen, dass es bei den Frauen, die unter Dolutegravir schwanger wurden, zu etwas mehr Fehlbildungen des Rückenmarks bei den Neugeborenen kam. Sofort wurde von den Gesundheitsbehörden eine Warnung für das Medikament herausgegeben mit der Empfehlung, das Medikament bei Frauen, die schwanger werden möchten, nicht mehr einzusetzen. Dies hatte weitreichende Konsequenzen, da es sich um ein sehr potentes Medikament handelte, mit dem Millionen von Frauen erfolgreich behandelt wurden. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent, wo aufgrund gesellschaftlicher Mechanismen viel mehr Frauen von HIV betroffen und aufgrund hoher Resistenzraten die Standard-HIV-Therapie oft nicht zu einer Unterdrückung der Viruslast führt. Als man schliesslich das Medikament Dolutegravir über längere Zeit in weiteren Geburtskohorten studierte und die Daten von Schwangerschaftsregistern genau analysierte, zeigte sich kein Anzeichen mehr für die erhöhte Missbildungsraten von Neugeborenen von Frauen, die unter Dolutegravir schwanger wurden.
Kreative Ansätze sind gefragt, kosten aber auch mehr
Die Teilnahme an medizinischer Forschung ist aber nicht nur während Schwangerschaft und Stillzeit schwierig, sondern auch aus anderen vereinbarkeitstechnischen Gründen. Welche Mutter oder in der Care-Arbeit engagierte Frau, vielleicht noch berufstätig, hat Zeit für lange Aufenthalte im Krankenhaus zwecks Studienvisiten, manchmal mehrmals in der Woche? Gerade da Frauen etwa vielerorts noch immer stärker in die Kinderbetreuung oder
Sorgearbeit eingebunden sind als die Väter und Männer. Und nicht zuletzt sind Frauen Studien gegenüber möglicherweise etwas skeptischer.
Dennoch ist es möglich, sie einzubinden. «Man muss einfach kreativer sein», sagt Braun. So hätten er und seine Kolleg_innen es in einer kürzlich schweiz- und weltweit durchgeführten HIV-Studie sehr wohl auf einen Anteil von einem Drittel Frauen geschafft – dank gezieltem Fokus auf den Einschluss von Frauen, Vergütung von Studienvisiten, bezahltem Taxidienst oder Babysitter-Angeboten. Das sei zwar aufwendig, doch lohne es sich, um Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit des Medikamen-tes bei Frauen erhalten zu können, sagt Braun. Ansätze, die hoffentlich in Zukunft Bestand haben werden.
Worauf Frauen achten sollten
- Die Dosierung eines verschriebenen Medikaments nie eigenmächtig herab- oder heraufsetzen.
- Sich nicht auf Internetforen verlassen, dort kursiert gefährliches Halbwissen.
- Ärztinnen, Ärzte auf Nebenwirkungen ansprechen, die unangemessen stark erscheinen, gerade in Bezug auf die Geschlechterthematik.
- Auf die Intuition hören und Signale des Körpers ernst nehmen, man kennt diese oft selbst am besten. Sollten diese besorgniserregend sein: beharrlich bleiben und sich nicht abspeisen lassen.
- Auf Symptome achten und deren Auftreten im dazugehörigen Kontext schriftlich festhalten.
- Im Zweifelsfall: Die Zweitmeinung einer weiblichen medizinischen Fachperson oder Ärztin einholen.
Buchtipps zum Thema
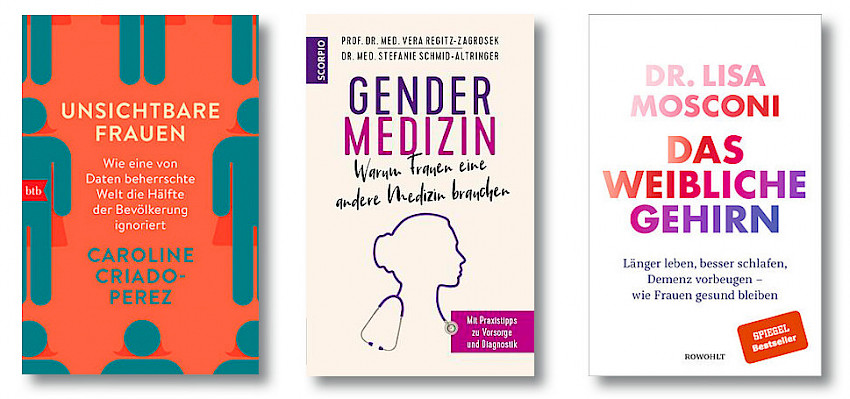
Unsichtbare Frauen
Unsere Welt ist von Männern für Männer gemacht und tendiert dazu, die Hälfte der Bevölkerung zu ignorieren. Caroline Criado-Perez erklärt, wie dieses System funktioniert. Sie legt die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten offen. Die so entstandene Wissenslücke liegt der kontinuierlichen und systematischen Diskriminierung von Frauen zugrunde und erzeugt eine unsichtbare Verzerrung, die sich stark auf das Leben von Frauen auswirkt. Kraftvoll und provokant plädiert Criado-Perez für einen Wandel dieses Systems und lässt uns die Welt mit neuen Augen sehen.
Caroline Criado-Perez: Unsichtbare Frauen. btb, 2020, 496 Seiten
Gender Medizin
Frauenkörper sind anders als Männerkörper. Kein Wunder, dass Frauen entsprechend oft andere Krankheiten (etwa Rheuma oder Osteoporose) entwickeln als Männer. Aber selbst bei gleicher Krankheit sind Risikofaktoren, Symptome und das Ansprechen auf Medikamente nicht immer identisch. Die Autorinnen erklären anschaulich, warum eine geschlechtersensible Medizin vor allem für Frauen lebenswichtig sein kann.
Vera Regitz-Zagrosek, Stefanie Schmid-Altringer: Gender Medizin. Scorpio, 2020, 280 Seiten
Das weibliche Gehirn
Frauen leiden häufiger als Männer an Migräne, Depressionen, Schlaganfällen – und doppelt so oft an Alzheimer. Woran liegt das? Wie unterscheidet sich das weibliche vom männlichen Gehirn? Die Neurowissenschaftlerin und Ärztin Lisa Mosconi weiss, wie wenig bisher über das weibliche Gehirn geforscht wurde und welche Folgen dies für die Gesundheit von Frauen hat. Sie beschreibt die drastischen Unterschiede zwischen dem weiblichen und männlichen Hirnstoffwechsel und zeigt auf, wie Frauen das Gehirn schützen können – durch Ernährung, Stressreduktion und besseren Schlaf.
Lisa Mosconi: Das weibliche Gehirn. Rowohlt, 2020, 432 Seiten